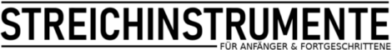- Geige
- Bratsche
- Cello
- Kontrabass
FGWDesign – stock.adobe.com
Bratsche kaufen: Tipps, Infos & Kaufratgeber
Die Bratsche ist die große Schwester der Geige. Etwas tiefer und größer als die Violine entfaltet das Streichinstrument aus dem 16. Jahrhundert beim Spielen seinen ganz eigenen und unverwechselbaren Charakter. Was man über Bratsche die auch als Viola oder Alto bezeichnet wird wissen muss und für wen sie das richtige Instrument ist, verraten wir in diesem Beitrag.
Empfehlenswerte Bratschen für Anfänger
#1 - Stentor SR1505 Viola Student II 16"
Günstiges Set für Einsteiger
Ein beliebtes Instrument für Anfänger ist diese günstige Bratsche von Stentor. Zum Lieferumfang gehören neben dem gut verarbeiteten Instrument ein einfacher Bogen sowie eine Tasche und damit alles, was man benötigt um direkt loslegen zu können. Der Klang ist warm und ausgewogen. 16 Zoll sind die typische Größe für Erwachsene.
Um so viel Streichinstrument für so wenig Geld anbieten zu können, findet die Fertigung in Asien statt. Mit modernen Verfahren und optimierten Arbeitsabläufen entstehen an diesen Standorten Schülerinstrumente mit hervorragender Preis-Leistung. Auch wenn die Qualität der Bratsche insgesamt hoch ist, können bei Streichinstrumenten aus dem unteren Preissegment kleinere Unregelmäßigkeiten auftreten, die unter anderem den Lack betreffen können. Die Viola hat eine Fichtendecke und einen massiven Ahornkorpus. Wirbel und Griffbrett bestehen aus Ebenholz, der Kinnhalter aus Hartholz.
Eine Viola die in erster Linie für Anfänger konzipiert ist, aber auch fortgeschrittenen Bratschisten noch Spaß machen kann wenn man den Bogen durch ein höherwertiges Modell ersetzt. Die Standardsaiten kann man aber auch schon in der Anfangszeit gegen bessere austauschen um den Klang zu optimieren. Einen guten Bratschenbogen bekommt man ab etwa 100 Euro und Bratschensaiten mit guten klanglichen Eigenschaften für etwa 50 Euro. Diese Investition ist am Anfang aber nicht nötig.
Die Stentor SR1505 Viola überzeugt mit einem vereinnahmenden Klang, guter Verarbeitung und ihrem günstigen Preis. Eine echte Empfehlung in dieser Preisklasse.
Thomann bietet neben 3 Jahren Garantie ein 30-tägiges Rückgaberecht an.

Bild: Thomann.de
Die Topseller bei Thomann
Was ist eine Bratsche?
Die Bratsche oder Viola gehört zur Familie der Streichinstrumente. Ihre Entwicklung erfolgte zeitgleich zu der der Violine. Sie klingt tiefer als eine Geige, hat aber eine höhere Tonlage als ein Cello.
Unterschiede zwischen Geige und Bratsche
Bratschen sind eine Quint tiefer gestimmt als Geigen. Beide Instrumente haben vier Saiten und teilen sich drei davon in der selben Stimmung. Nämlich A-Saite, D-Saite und G-Saite. Die hohe E-Saite die der Violine die für sie typischen hohen und eindringlichen Töne ermöglichen die direkt in die Seele dringen und für Gänsehaut sorgen, fehlt der Viola. Dafür kann die Bratsche dank ihrer tiefen C-Saite welche wiederum bei der Violine fehlt, Töne hervorbringen die herber und maskuliner oder schlicht dunkler, fast schon melancholisch, dabei aber voll, anmuten. Die Viola bleibt eher im Schatten, während die Violine führt. Es handelt sich um zwei Streichinstrumente mit vielen Gemeinsamkeiten aber einem ganz anderen Flair.
Wie sieht eine Bratsche aus?
Violinen bringen es auf eine Korpuslänge von knapp 36 Zentimetern. Bratschen sind etwas größer. Während die kleine Bratsche eine Länge von circa 39 Zentimetern hat, ist die große Bratsche mit bis zu 43 Zentimetern sogar noch größer. Auch die Bögen der beiden Instrumente sind fast identisch, wobei ein Bratschenbogen meist an der abgerundeten Kante zu erkennen und etwas schwerer ist als ein Geigenbogen. Am Ende ist keines der beiden Streichinstrumente dem anderen überlegen. Jedes ist sehr anspruchsvoll zum erlernen und bietet ein gewaltiges Spektrum an musikalischen Möglichkeiten.
Die Geschichte der Bratsche
Ihre Ursprünge hatte die Bratsche bereits im 16. Jahrhundert. Ein Geigenbauer namens Gasparo da Salò hat das Instrument gebaut, das rasch auch Einzug in Sinfonieorchester finden sollte. Die italienische Bezeichnung für Bratsche lautet Viola, im Französischen nennt man sie alto. Die Mehrzahl von Viola lautet Violen. Die Herkunft des Wortes Bratsche ist auf die Sammelbezeichnung Viola da braccio, die Familie aller Streichinstrumente des 16. Jahrhunderts in Violinform einschließt. Viola da braccio heißt aus dem Italienischen übersetzt Armgeige. Viola bedeutet Geige, braccio Arm. Verwendet man die Bezeichnung im Plural, lautet sie entsprechend Viole da braccio. Es lässt sich bereits erahnen, dass die heute gängigen Bezeichnungen Bratsche und Viola sich von diesem ursprünglichen Begriff ableiten. Man spricht auch von der Armgeige, was auf die Haltung zurückzuführen ist. Anders als bei Instrumenten aus der Viola-da-gamba-Familie die zwischen den Beinen gehalten werden, hält der Bratschist die Armgeige entsprechend auf dem Arm.
Die Geige wurde damals als Soloinstrument aber vorgezogen – weil sie einfach kompakter war, besser zu handeln und auch leichter zu greifen weil die damaligen Bratschen noch um einiges größer waren als sie moderne Ausführungen. Man brauchte also eine gute Spreizfähigkeit der Finger und im Idealfall große Hände. In den 1740er Jahren kam dann eine kompaktere Bauart zum Einsatz die das Streichinstrument dann angenehmer zum Spielen machte. Gerade in der Kammermusik kann die Viola ihre Stärken voll ausspielen und kommt dort gerne zum Einsatz. In Kombination mit Cello, Geige und Kontrabass ergibt sich ein stimmiges Streichquartett das ein umfangreiches Repertoire bedienen kann. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden fast 150 Konzerte für Bratsche. Nach dieser Zeit war das Musikinstrument nicht mehr so präsent, da sich in Romantik und Moderne die Schwerpunkte verschoben haben. Deshalb entstanden hier auch kaum noch Werke speziell für die Bratsche. Auch heute noch steht die Viola etwas im Windschatten von der Geige die einfach populärer ist. Auf italienisch heißt die Bratsche übrigens Viola und auf französisch heißt sie Alto. Auch im Englischen kennt man das Instrument als viola. Im 16. und 17. Jahrhundert hatten Violen ihre Hochphase. Aus ihnen gingen dann die späteren Instrumente Violine, Viola und Violoncello hervor, die die Violinfamilie bildeten.
Eigentlich zu klein geraten
Vergleicht man die beiden Streichinstrumente fällt auf, dass die Bratsche nicht einfach nur eine größere Geige ist. Dies wäre der Fall, wenn das Instrument die selben Proportionen wie eine Violine hätte. Für den tieferen Klang der Bratsche wäre ein größerer Korpus eigentlich vorteilhafter. Ihr typischer Klangcharakter kommt aber gerade deshalb zustande, weil der Korpus etwas zu klein dimensioniert ist für ihre Stimmung. Dass die Bratsche keine 54 Zentimeter lang ist, das würde im Grunde Sinn machen, ist darauf zurückzuführen, dass die Bratsche wie schon beschrieben etwas verkleinert wurde um sie praktischer und komfortabler zu gestalten. Ein kleineres Instrument ist schlicht besser bespielbar und daran hat und wird sich auch nichts ändern. Die heutige Form ist also das Ergebnis einer langen Entwicklung.
Bratsche lernen: Für wen ist die Bratsche das richtige Instrument?
Grundsätzlich für jeden, der Interesse an dem Streichinstrument und seinem Klangcharakter hat. Weil die Geige einfach beliebter ist, findet sich hier zwar umfangreichere Lektüre zum Bratsche lernen und auch das Repertoire für die Geige welches im Laufe der Jahrhunderte entstanden ist ist größer – aber auch für die Viola gibt es alles was man braucht und selbstverständlich auch den passenden Musiklehrer. Es ist also eine Frage der persönlichen Präferenzen. Wer Bratsche lernen möchte, sollte dies auch tun und nicht nur deshalb zur Geige greifen, weil sie populärer ist und es mehr Geiger und Geigenschüler gibt. Beherrscht man die Viola irgendwann, eröffnen sich so zahlreiche Möglichkeiten sich musikalisch in Orchestern einzubringen. Auch deshalb, weil es weniger Bratschenspieler gibt als Geiger. Kinder beginnen in der Regel mit der Violine und steigen später auf die Bratsche um, wenn sich ihr Interesse hin zum tieferen Instrument verschiebt oder ihre körperlichen Gegebenheiten wie Armlänge oder Handgröße einen Wechsel sinnvoll machen.
Technik beim Bratsche spielen
Im Handling ist die Bratsche anspruchsvoller als die Geige. Das liegt an der längeren Mensur, die für größere Abstände zwischen den Tönen sorgt. Die Greifhand ermüdet schneller, weil die Finger in größerem Umfang als bei der Violine gespreizt werden müssen. Die Schwierigkeit liegt darin, in der gespreizten Position genug Flexibilität in den Fingern aufrecht zu erhalten, um ohne Einschränkungen spielen zu können. Mit der richtigen Technik und viel Übung lässt sich die Bratsche am Ende aber meistern und ebenso perfekt spielen wie die Geige. Aufgrund ihrer Größe beansprucht die Viola zudem den Halteapparat stärker als die Violine. Beschwerden in Schulter, Arm oder Rücken sind wahrscheinlicher, was mitunter auf die Armposition auf der Körperseite der Greifhand zurückzuführen ist. Um greifen zu können, muss man den Arm beim Bratsche spielen wie bei der Geige entsprechend drehen. Weil man bei der Viola den Arm weiter strecken muss, wird diese Drehung oder Supination schwieriger. Eine korrekte Technik bewahrt den Bratschisten vor Verschleiß und Verletzungen des passiven Bewegungsapparates, wie dem Ellbogengelenk, oder dem gefürchteten Tennis- bzw. Golferarm.
Notation im Bratschenschlüssel
Die Bratsche wird als einziges Streichinstrument im Altschlüssel notiert. Eine andere Bezeichnung ist auch Bratschenschlüssel. Auf der Mittellinie liegt bei diesem Notenschlüssel ein C. Gelegentlich nennt man ihn deshalb auch C-Schlüssel. Weil man mit der Viola in der Regel sehr tiefe Töne spielt, erspart man sich mit diesem speziellen Schlüssel unnötige Hilfslinien. Bei hohen Tönen muss man aber auf den Violinschlüssel zurückgreifen.
Wie groß ist eine Bratsche?
Bratschen haben eine Korpuslänge von etwa 40 bis 43 cm. Die Größe kann aber auch davon abweichen. Meist ist sie aber nicht kürzer als 38 und nicht länger als 47 cm.
Aufbau der Bratsche
Von anderen Größenverhältnissen abgesehen gleichen sich Bratsche und Violine. Hier eine Abbildung mit dem Aufbau von Geige und Bratsche.
Die richtige Bratschen-Größe
Anders als bei den restlichen Streichinstrumenten gibt es bei Bratschen keine einheitlichen Größen. Angaben wie 1/2 oder 3/4 findet man bei der Viola deshalb nicht. Stattdessen wird die Länge in Zoll angegeben. Üblicherweise liegt sie zwischen 12 und 17 Zoll, was etwa 30 bis 43 Zentimeter entspricht. Etabliert hat sich die Bratschen-Größe 16 Zoll, was einem Instrument von 40 Zentimeter Länge entspricht. Um die richtige Größe zu ermitteln, misst man die Armlänge. Eine Tabelle gibt dann einen Anhaltspunkt, welche Größe passt.
Die Bratsche im Orchester
Bratschen sind im Orchester ein wichtiges Bindeglied zwischen Violinen und Celli. Die Violine dominiert die Melodieführung aber jederzeit. Man findet Bratschisten oft in der Mitte des Orchesters, zwischen Celli und Zweiten Geigen. Der Dirigent steht vor den Streichern. Die Bratschen hat er, in der Regel leicht rechts versetzt, gut im Blick. Die Bratschen kommen so voll zur Geltung. Manchmal findet sich aber auch eine andere Sitzordnung. Die Bratschen können auch weiter links oder rechts platziert werden. Eine Konstellation, die man bei Sinfonieorchestern regelmäßig antrifft, setzt sich aus 8 Celli, 12 Bratschisten und 14 Zweiten Geigen zusammen. Den ersten Bratschisten bezeichnet man auch als Solo-Bratschist. Seine Aufgabe besteht darin, Solopassagen zu spielen falls diese vorkommen und seine Stimmgruppe anzuführen.
Wieso ist die Geige populärer als die Bratsche?
Die Viola fristet seit Jahrhunderten ein Dasein im Windschatten der Violine. Viele Menschen wissen noch nicht einmal so richtig, was eine Bratsche oder Viola überhaupt ist. Weil die Violine über Jahrhunderte das maßgebliche Streichinstrument für die Melodieführung im Orchester war, hat sich in dieser langen Zeit auch viel mehr Geigenliteratur angehäuft. Die Auswahl an Noten zu Stücken aus Klassik, Pop & Co ist deshalb groß. Weil die Geige nach wie vor beliebter ist, entsteht auch viel mehr Geigenliteratur. Weil Geigenspieler viel bekannter sind als Bratschisten, geben sie auch bessere Vorbilder ab und mehr angehende Geiger eifern ihnen nach. Es ist auch einfacher einen Geigenlehrer zu finden.
Noten für die Bratsche
Eine große Auswahl an Noten für die Viola gibt es bei Thomann*.
Bratschenbogen
Der Bratschenbogen besteht aus den selben Bauteilen wie die anderen Streichbögen. Sein Gewicht ist etwas höher, um auch beim Streichen über die tiefste Saite einen vollen Ton erzeugen zu können. Es handelt sich um etwa 10 bis 15 Gramm. Die Kante ist in der Regel abgerundet. Auch bei den Materialien kommen klassische Werkstoffe wie Fernambuk oder Carbon zum Einsatz. Weil die Bestände des brasilianischen Tropenholzes dramatisch zurückgegangen sind, ist die Kohlenstofffaser Carbon heute Standard im unteren und mittleren Preissegment. Für Fernambuk oder Brasilholz muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen. Bei der Bespannung handelt es sich wie bei den anderen Bögen um Rosshaar das nicht nur äußerst robust ist, sondern aufgrund seiner rauen Struktur in Verbindung mit dem richtigen Kolophonium auch für ein optimales klangliches Ergebnis sorgt. Nicht vegan, aber bewährt und gegenwärtig nicht durch synthetisches Haar ersetzbar, da diese noch nicht an die Qualität des Originals heranreichen. Wie bei Violinbögen besteht auch beim Bratschenbogen der Frosch meist aus Ebenholz, während Silber, Neusilber oder Gold für die metallenen Beschläge verwendet wird. Ein guter Bratschenbogen überzeugt mit ordentlicher Verarbeitung, hochwertigen Materialien und einem ordentlichen Ton. Auch haptisch muss ein Streichbogen einem zusagen – sich sofort richtig anfühlen. Vom günstigen Carbonbogen aus einer ostasiatischen Fabrik bis zum teuren Holzbogen vom Bogenbauer gibt es teilweise riesige Unterschiede was Klang und Verarbeitungsqualität betrifft. Ein Meisterbogen muss aber nicht besser sein als ein deutlich günstigerer Violabogen. Deshalb sollte man innerhalb seines individuellen Budgets mehrere Bratschenbögen ausprobieren und auch günstigere mit etwas teureren vergleichen und dann entscheiden, ob die hörbaren und qualitativen Unterschiede den Aufpreis rechtfertigen. Einen teuren Streichbogen kann man auch als Fortgeschrittener jederzeit kaufen. Um das volle Klangspektrum einer Bratsche ausschöpfen zu können müssen Instrument, Bogen und Kolophonium ein harmonisches Trio ergeben. Am Ende entscheidet aber der Bratschist darüber, wie gut er klingt. Denn selbst eine mittelmäßige Viola in Kombination mit einem schlechten Streichbogen kann gut klingen, wenn ein guter Musiker sie spielt. Beim Kolophonium wird auch bei der Bratsche eher auf eine harte Variante zurückgegriffen. Mehr dazu in unserem Ratgeber zu Kolophonium.
Bratsche kaufen: Wie hoch ist der Preis für eine Viola?
Die Preise für Bratschen reichen von 100 Euro für ein günstiges Fernost-Instrument bis zu unglaublichen Summen die im Millionenbereich liegen können. Eine Meisterbratsche vom Geigenbauer kostet in der Regel einige tausend Euro. Für Anfänger sind vor allem Schülerinstrumente interessant die schon für ein paar hundert Euro zu bekommen sind. Hierbei handelt es sich um Bratschen die meist in Asien unter hohen Fertigungsstandards hergestellt werden. Klanglich sind viele dieser Streichinstrumente – vor allem wenn man den Preis betrachtet – schon sehr gut. Mit 300 bis 800 Euro sollte man für ein solides Einsteigerinstrument schon rechnen. Bei diesen Violen handelt es sich häufig um Sets denen auch Tasche und Bogen beiliegen. Gerade im unteren Preissegment handelt es sich meist um einen schlechten Bratschenbogen, der durch einen besseren ersetzt werden sollte. Wer eine Viola für 300 Euro kauft kann auch davon ausgehen, dass die Bratschensaiten keine hohe Klangqualität aufweisen. Hier bewirkt ein Upgrade oft Wunder.
Brauchbare Bögen bekommt man schon ab 100 Euro – teilweise noch günstiger. Natürlich sind diese nicht mit Ausführungen vom Bogenmacher vergleichbar.
Eine Option sind gebrauchte Bratschen – hier sollte man sich aber unbedingt fachmännisch beraten lassen oder am besten gleich bei einem lokalen Geigenbauer kaufen. Hier weiß man was man bekommt und hat auch für die Zukunft einen Ansprechpartner vor Ort. Viele gebrauchte Instrumente entpuppen sich im Nachhinein als sehr kostspielig weil man sie einstellen muss und gegebenenfalls Reparaturen fällig werden.
Bei Geigenbauern kann man auch Streichinstrumente mieten um zu sehen, ob das Ganze überhaupt zu einem passt und Freude macht. Beim Mietkauf werden bereits bezahlte Raten auf den Kaufpreis angerechnet, wenn man sich dafür entscheiden sollte, die Bratsche zu kaufen. Generell sind Instrumente vom Geigenbauer sorgfältig verarbeitet und bei Versand oder Übergabe an Kunden spielfertig eingerichtet, damit man direkt loslegen kann.
Beachten muss man beim Kauf einer Viola auch, dass Korpusgröße und Saitenlänge im Gegensatz zu Geige und Cello variieren. Größere Bratschen haben auch ein volleres Klangvolumen als kleinere Instrumente. Weil das Griffbrett ebenfalls größer ausfällt, sind auch die Tonabstände weiter was Schwierigkeiten beim Greifen bereiten kann. Gerade mit kleinen Händen sollte man deshalb von großen Violen, die allgemein unhandlicher und schwerer sind, absehen. Wer das Streichinstrument erlernen möchte, macht mit einer Bratsche mit einer Korpuslänge von 39,5 cm nichts falsch. Entscheidet man sich später dafür als Solist durchzustarten, kann man jederzeit zu einem größeren Instrument wechseln.
Saiten für die Bratsche
Du willst endlich Cello spielen? Egal wie alt du bist - es ist nie zu spät anzufangen. Das vielseitige Streichinstrument ist natürlich auch für den Nachwuchs eine tolle Sache. Alles was du wissen musst, verraten wir dir auf dieser Seite.
Als Teilnehmer am Amazon Partnerprogramm verdienen wir bei Verkäufen über unsere Produktlinks, die Werbelinks darstellen, eine Provision. Bei Links die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, handelt es sich um Affliate-Links.
Als Teilnehmer am Amazon Partnerprogramm verdienen wir bei Verkäufen über unsere Produktlinks, die Werbelinks darstellen, eine Provision. Bei Links die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, handelt es sich um Affliate-Links.
© streichinstrumente.net